|
|
Tilps Page |
|
PV-Anlage - Balkonkraftwerk/Steckersolaranlage
Tipps - Regeln und Gesetze
Verbrauchsstromkreis und Endstromkreis
Stand 14.12.2025
![]() Prolog
Prolog
![]() Youtube-Videos
Youtube-Videos
![]() Website-Artikel
Website-Artikel
![]() Gesetze / Verordnungen
Gesetze / Verordnungen
![]() VDE-Normen / DIN-Normen
VDE-Normen / DIN-Normen
![]() Google-KI:
Google-KI:
![]() Endstromkreis
Endstromkreis
![]() Balkon-Stromkreis
Balkon-Stromkreis
![]() Verbrauchsstromkreis
Verbrauchsstromkreis
![]() Steckersolaranlagen
Steckersolaranlagen
![]() Solarpaket I
Solarpaket I
![]() Solarpaket II
Solarpaket II
![]() Solarspitzengesetz
Solarspitzengesetz
![]() Netzdienlichkeit
Netzdienlichkeit
![]() Hintergrund: Energiewende
Hintergrund: Energiewende
• Prolog
Ausgangspunkt für das Folgende ist ein größeres modernes Mehrfamilinenhaus (WEG) mit vielen Balkonen und mit begrüntem Flachdach. Die aufgeführten Links (ursprünglich mit Schwerpunkt auf Balkonkraftwerke) auf Videos und Artikel in den digitalen Medien sollen Appetit machen auf eigene diesbezügliche Recherche. Später wurden Links für Dach-PV-Anlagen hinzu genommen. Die verlinkten Gesetze befassen sich sowieso mit PV-Anlagen allgemein. Die Auswahl aller Links ist sicher unvollständig und daher subjektiv!
Aber die dabei mittlerweile von Google angebotenen KI-generierten Zusammenfassungen sind mit Vorsicht zu genießen (s.u.).
Bestes Beispiel dafür sind die beiden Fachbegriffe Endstromkreis und Verbrauchsstromkreis; vergleiche diesbezüglich die von Menschen erstellten Videos mit den von Programmen erstellten KI-Zusammenfassungen.
⋄
Das Solarpaket I vom April 2024 erlaubt Balkonkraftwerke (= BKW = Steckersolargeräte) mit PV-Paneelen bis zu inges. 2000 Watt (Wp, als Gleichstrom) Modulleistung, die mit einem Wechselrichter bis zu max. 800 Watt (VA, als Wechselstrom) Anschlussleistung ins Wohnungsnetz einspeisen können.
Das damals vorbereitetete Solarpaket II ist im Trubel der Regierungskrise Ende 2024 stecken geblieben und wurde wohl durch das Solarspitzengesetz vom 25.02.2025 "ersetzt".
⋄
Eines der Ziele der Energiewende-Maßnahmen muss letzlich die Netzdienlichkeit sein, sonst wird's teuer und instabil! Ab September 25 wurden Bestrebungen bekannt, einerseits die Netzdienlichkeit zu forcieren, andererseits den PV-Ausbau zu regulieren/bremsen:
- Früher erfolgte die Stromversorgung ausschließlich "von oben", also zentral und gut überwacht und vernetzt über Kohle-, Gas- und
Kernkraftwerke, in denen große Generatoren mit riesigen Schwungmassen teils rund um die Uhr untereinander synchronisiert mit
konstanter Umdrehungszahl liefen und so die Netzfrequenz auf konstanten 50 Hz stabilisierten.
- Aber mittlerweile werden bis zu ⅔ des benötigten Stroms durch "Ökostrom" gedeckt, der "von unten", also dezentral/lokal eingespeist
wird, das aber schwankend/wetterabhängig und ohne eigene Synchronisationsqualität bez. Netzfrequenz.
⋄
• Youtube-Videos:
∘ Steckersolaranlagen/Balkonkraftwerke ("laienbedienbare, steckerfertige Photovoltaik-Systeme für den Netzparallelbetrieb"):
![]() Tips, Tricks & More: Schuko-Stecker mit Schalter! Ist das euer ernst?
Tips, Tricks & More: Schuko-Stecker mit Schalter! Ist das euer ernst?
- Balkonkraftwerk-Norm im Check mit Holger Laudeley
(30.11.2025 | 21:52)
![]() Andreas Schmitz:Neue VDE-Balkonsolar-Norm:
Andreas Schmitz:Neue VDE-Balkonsolar-Norm:
Diese Grenze macht ALLES kaputt!
(26.11.2025 | 23:03)
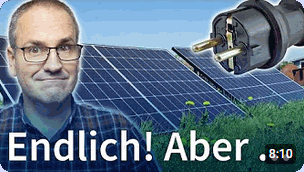
![]() heise & c't: Balkonkraftwerk: Schuko-Stecker endlich erlaubt - aber mit Haken
heise & c't: Balkonkraftwerk: Schuko-Stecker endlich erlaubt - aber mit Haken
(17.11.2025 | 08:09)
- Normaler Schuko-Stecker ist jetzt VDE-normgerecht an Endstromkreisen zugelassen:
DIN VDE V 0126-95 VDE V 0126-95:2025-12 Steckersolargeräte für Netzparallelbetrieb
- Aber nur zulässig mit bis zu 960 W *) Modulleistung und 800 W Anschlussleistung und
ohne Batteriespeicher, dann ohne Elektriker, darüber hinaus mit Elektriker,
dann auch nur bis 2000 W Modulleistung.
- Für Speichersysteme ist eine separate Norm geplant.
- Durch das Solarpaket I sind bis zu 2000 W *) erlaubt, aber die VDE-Norm regelt das anders!
Siehe auch ![]() heise online: Schuko-Stecker offiziell solartauglich, DIN für Balkonkraftwerke ist fertig
heise online: Schuko-Stecker offiziell solartauglich, DIN für Balkonkraftwerke ist fertig
![]() gewaltig nachhaltig: Neue Produktnorm für Balkonkraftwerke
gewaltig nachhaltig: Neue Produktnorm für Balkonkraftwerke
- weder Fisch noch Fleisch
(16.11.2025 | 09:09)


![]() VDI Karlsruhe: Anforderungen an Stromkreise zum
VDI Karlsruhe: Anforderungen an Stromkreise zum
Betrieb von Balkonkraftwerken ← Theorie, Grundlagen
(08.11.2023 | 1:19:05)
![]() Offys Werkstatt: Einspeisen ins Hausnetz: Wann wird's
Offys Werkstatt: Einspeisen ins Hausnetz: Wann wird's
riskant? Mein Praxis-Test Praxis mit Testaufbau →
(13.09.2025 | 21:58)
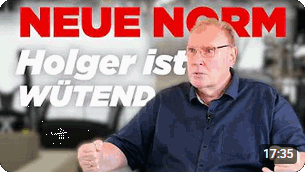
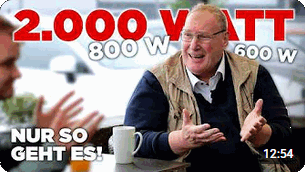
![]() Tips, Tricks & More: Das Ende der Balkonkraftwerke?
Tips, Tricks & More: Das Ende der Balkonkraftwerke?
Die neue IEC-Norm im Faktencheck
(03.08.2025 | 17:34)
![]() Tips, Tricks & More: 2.000W Balkonkraftwerk:
Tips, Tricks & More: 2.000W Balkonkraftwerk:
So darf es NICHT gemacht werden!
(02.09.2024 | 12:53)
∘ Geplante Restriktionen:


![]() Der Fachwerker: Wie geht es jetzt mit
Der Fachwerker: Wie geht es jetzt mit
unseren PV Anlagen weiter?
(03.09.2025 | 20:28)
![]() gewaltig nachhaltig: Alle aktuellen Photovoltaik Regelungen
gewaltig nachhaltig: Alle aktuellen Photovoltaik Regelungen
und wie man das Beste daraus macht
(14.09.2025 | 18:20)
Siehe auch rot markierten Kasten ![]() weiter oben
weiter oben
∘ Flachdach-PV-Anlagen:
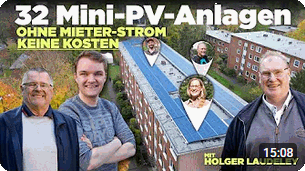

![]() Tips, Tricks & More: Balkonkraftwerke XXL:
Tips, Tricks & More: Balkonkraftwerke XXL:
1. PV-Anlage + Speicher für JEDEN Mieter!
(17.03.2025 | 15:07)
![]() Tips, Tricks & More: Balkonkraftwerke XXL:
Tips, Tricks & More: Balkonkraftwerke XXL:
2. So haben wir uns das nicht vorgestellt..!
(30.03.2025 | 20:45)

![]() Tips, Tricks & More: Balkonkraftwerke XXL:
Tips, Tricks & More: Balkonkraftwerke XXL:
3. Hat es sich wirklich gelohnt?!
(13.04.2025 | 17:25)
∘ Gründach und PV:


![]() Tips, Tricks & More: PV-Module hochkant?!
Tips, Tricks & More: PV-Module hochkant?!
So setzt man eine Gründach PV-Anlage um
17.08.2025 (22:33)
![]() Felix Goldbach: Vertikale PV Anlage mit mehr Ertrag im Winter?
Felix Goldbach: Vertikale PV Anlage mit mehr Ertrag im Winter?
Photovoltaik mit bifazialen Solarmodulen
16.05.2025 (11:50)
• Website-Artikel:
= Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur Vermeidung von temporären Erzeugungsüberschüssen
"Die Hager Tipps erklären Normen, Gesetze, Installationsvorgaben u. v. m. kurz, knapp und verständlich."
• Gesetze / Verordnungen:
"Solarpaket I" (Artikel-Gesetz) vom 8. Mai 2024:
Artikel 1: Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
Artikel 2: Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes
Artikel 3: Änderung der Marktstammdatenregisterverordnung
Artikel 4: Änderung des Energieleitungsausbaugesetzes
Artikel 5: Änderung des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes Übertragungsnetz
Artikel 6: Änderung des Bundesbedarfsplangesetzes
Artikel 7: Änderung des Messstellenbetriebsgesetzes
Artikel 8: Änderung der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung
Artikel 9: Änderung der KWK-Ausschreibungsverordnung
Artikel 10:Änderung des Windenergie-auf-See-Gesetzes
Artikel 11:Änderung des Energiefinanzierungsgesetzes
Artikel 12:Änderung des Windenergieflächenbedarfsgesetzes
Artikel 13:Änderung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung
"Solarspitzengesetz" = EnGW-Novelle 2025 (Artikel-Gesetz) vom 24.02.2025:
Artikel 1: Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes
Artikel 2: Änderung des Messstellenbetriebsgesetzes
Artikel 3: Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
Artikel 4: Weitere Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
Artikel 5: Änderung der Erneuerbare-Energien-Verordnung
Artikel 6: Änderung der Innovationsausschreibungsverordnung
Artikel 7: Änderung des Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes
Artikel 8: Änderung des Energiefinanzierungsgesetzes
• VDE-Normen / DIN-Normen:
Der ![]() VDE ist ein eingetragener Verein, also kein Gesetzesorgan. Die von ihm herausgegebenen VDE-Normen sind daher im Gegensatz zu den amtlichen Rechtsnormen/Gesetzen/Verordnungen leider nur gegen Bezahlung verfügbar, obwohl jeder Bürger auch von den VDE-Normen täglich betroffen ist. Änliches gilt für den e.V.
VDE ist ein eingetragener Verein, also kein Gesetzesorgan. Die von ihm herausgegebenen VDE-Normen sind daher im Gegensatz zu den amtlichen Rechtsnormen/Gesetzen/Verordnungen leider nur gegen Bezahlung verfügbar, obwohl jeder Bürger auch von den VDE-Normen täglich betroffen ist. Änliches gilt für den e.V. ![]() DIN.
DIN.
Gleichwohl wird in allen juristischen Auseinandersetzungen die Einhaltung von VDE- und DIN-Normen geprüft und gewertet! Daher bleibt es sehr fragwürdig, dass man dafür bezahlen muss, wenn man erfahren will, wie man sich Norm-rechtlich verhalten darf.
Schließlich muss man z.B. auch nichts dafür bezahlen, dass man erfahren will, welche Pflichen man Steuer-rechtlich hat.
⋄
• Googles Hinweis zu Zusammenfassungen von Google-KI:
"KI-Antworten können Fehler enthalten. Zur Beratung in rechtlichen Fragen solltest du dich an einen Experten wenden."
Diesen Hinweis muss man unbedingt ernstnehmen, vor allem bei technischen Fragen, denn die KI sucht auch nur zusammen, was im Netz so rumschwimmt, hat dabei aber Schwierigkeiten beim Verständnis und mit dem trennscharfen Einsatz der einschlägigen Fachbegriffe und fängt oft an zu "schwafeln". Und das führt leicht zu leeren, falschen oder widersprüchlichen Aussagen, wie einige der folgenden Zusammenfassungen zeigen! Also bitte nicht alles wörtlich nehmen, sondern kontextbezogen hinterfragen!!!
Hervorhebungen und Farbe wurden von mir in den Zusammenfassungen nachträglich eingefügt.
• Endstromkreis (Zusammenfassung von Google-KI)
Ein Endstromkreis ist ein elektrischer Stromkreis, der eine oder mehrere Steckdosen direkt mit einer Sicherung in der Hausverteilung versorgt und keine weiteren Geräte anschließt, also ideal für leistungsintensive Geräte wie Waschmaschinen, Trockner oder auch einphasige E-Herde ist. Die Verwendung eines Endstromkreises wird auch für steckerfertige PV-Anlagen wie Balkonkraftwerke empfohlen, da er die sichere Nutzung von 2000 Watt (oder mehr) gewährleistet und somit hohe Sicherheitsstandards nach VDE-Richtlinien erfüllt.
• Merkmale eines Endstromkreises:
∘ Direkte Verbindung:
Der Stromkreis ist direkt mit der Sicherung in der Verteilung verbunden und wird nicht durch andere Verbraucher verzweigt.
∘ Hohe Leistung:
Er ist für den Anschluss von Geräten mit hohem Leistungsbedarf konzipiert, wie z. B. Waschmaschinen, Trockner oder E-Herde.
∘ Sicherheit:
Die direkte Anbindung an eine eigene Sicherung gewährleistet eine hohe Sicherheit und Schutz vor Überlastung.
• Anwendung bei Balkonkraftwerken:
∘ Empfehlung:
Für die sichere Nutzung der vollen Leistung eines Balkonkraftwerks (z.B. bis 2000 Watt) wird ein Endstromkreis empfohlen.
∘ Vorteile:
Ein Endstromkreis sorgt dafür, dass die 2000 Watt sicher genutzt werden können und vermeidet Probleme, die durch die Einspeisung
in einen allgemeinen Verbraucherstromkreis entstehen könnten.
∘ VDE-Vorgaben:
Nach VDE-Richtlinien (= VDE V 0100-551-1) ist die Nutzung eines Endstromkreises für die Steckdose auf dem Balkon notwendig,
um die Sicherheit zu gewährleisten.
∘ Unterschied zu Verbraucherstromkreisen:
Ein Verbraucherstromkreis ist ein Sammelbegriff für mehrere Steckdosen in einem Stromkreis, an die zahlreiche Geräte
angeschlossen werden. Im Gegensatz zum Endstromkreis versorgt ein Verbraucherstromkreis mehrere Geräte, was nicht für die
sichere Nutzung hoher Leistungen geeignet ist.
• Balkon-Stromkreis (Zusammenfassung von Google-KI)
Ein Balkon-Stromkreis bezieht sich in erster Linie auf den einzelnen Stromkreis in Ihrem Haus, an den ein Balkonkraftwerk angeschlossen wird. Die gesetzliche Vorschrift besagt, dass ein Balkonkraftwerk nur an einen einzelnen Stromkreis angeschlossen werden darf, um eine Überlastung zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten. Die maximale zulässige Einspeiseleistung des Wechselrichters beträgt aktuell 800 Watt, obwohl die Solarmodule selbst mehr Leistung erzeugen können. Der Anschluss erfolgt normalerweise über eine spezielle, fest installierte Wieland-Steckdose, ist aber in vielen Fällen auch über eine normale Schuko-Steckdose zulässig, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt sind.
• Warum nur ein Stromkreis?
∘ Technische Sicherheit:
Eine Verbindung an mehrere Stromkreise kann zu einer Überlastung der Leitungen und Sicherungen führen, was ein Sicherheitsrisiko
darstellt.
∘ Technische Limitierung:
Die Leistung eines Balkonkraftwerks ist darauf ausgelegt, in einen einzelnen Stromkreis eingespeist zu werden.
∘ Vermeidung von Rückfragen:
Die einzelnen Stromkreise in einem Haus sind in der Regel klar getrennt. Das Anschließen an nur einen Stromkreis stellt sicher, dass
die erzeugte Energie korrekt verteilt wird und keine unvorhergesehenen Effekte in anderen Teilen des Stromnetzes entstehen.
• Was ist der Unterschied zwischen dem Balkonkraftwerk und dem Stromkreis?
∘ Das Balkonkraftwerk:
Das ist die gesamte Anlage, bestehend aus einem oder mehreren Solarmodulen, einem Wechselrichter und den Anschlusskabeln.
∘ Der Stromkreis:
Das ist die elektrische Leitung im Haus, an die das Balkonkraftwerk angeschlossen wird, beispielsweise die Steckdose in der Küche
oder im Wohnzimmer.
• Worauf Sie achten sollten:
∘ Anschluss an die vorhandene Anlage:
Das Balkonkraftwerk wird normalerweise über einen Anschluss an den Stromkreis angeschlossen und speist den erzeugten Strom dort
ein.
∘ Wahl der richtigen Steckdose:
Es ist wichtig, dass der Anschluss an eine Steckdose erfolgt, die für die Last des Balkonkraftwerks ausgelegt ist. Die Verwendung einer
speziellen Wieland-Steckdose ist sicherheitstechnisch die beste Lösung, aber eine normale Schuko-Steckdose kann unter
bestimmten Bedingungen ebenfalls erlaubt sein.
∘ Anmeldung:
Vergessen Sie nicht, Ihr Balkonkraftwerk vor der Inbetriebnahme im Marktstammdatenregister zu registrieren.
• Verbrauchsstromkreis (Zusammenfassung von Google-KI)
Ein Verbrauchsstromkreis ist der herkömmliche Stromkreis in einem Haus oder einer Wohnung, an dem mehrere Steckdosen und Geräte angeschlossen sind und der direkt aus dem Zählerschrank gespeist wird. Im Gegensatz zu einem Endstromkreis, der nur einer einzelnen Steckdose zugeordnet ist, werden hier üblicherweise Geräte wie Fernseher, Lampen oder andere Haushaltsgeräte betrieben. Die Bezeichnung ist relevant, da sie im Kontext von Balkonkraftwerken und der Debatte um neue technische Normen eine Rolle spielt, die den Anschluss regeln sollen.
• Wichtige Merkmale eines Verbrauchsstromkreises:
∘ Mehrere Steckdosen:
An einem Verbrauchsstromkreis sind in der Regel mehrere Steckdosen für die Nutzung im Haushalt angeschlossen.
∘ Anschluss am Zählerschrank:
Die Leitung für den Verbrauchsstromkreis geht direkt vom Zählerschrank aus.
∘ Universelle Nutzung:
Hier werden die gängigen Haushaltsgeräte angeschlossen, wie zum Beispiel Fernseher, Radios oder Lampen.
• Bedeutung im Zusammenhang mit Balkonkraftwerken:
∘ Bisherige Praxis:
Bisher war es bei kleineren Balkonkraftwerken bis zu einer bestimmten Leistung (z. B. 800 W) üblich, sie einfach an einen
Verbrauchsstromkreis anzuschließen.
∘ Aktuelle Debatte:
Es gibt Diskussionen und Forderungen, Balkonkraftwerke künftig nur noch an speziellen Endstromkreisen zu betreiben, die direkt
für die einzelne Steckdose ausgelegt sind und einen separaten Anschluss erfordern.
∘ Technische Anforderungen:
Diese Forderung könnte zukünftig den Anschluss von Balkonkraftwerken erschweren und insbesondere für Mieter eine größere
Herausforderung darstellen, da sie aufwendige Installationen erfordern könnte.
• Steckersolaranlagen (Zusammenfassung von Google-KI)
Seit Inkrafttreten des Solarpakets 1 dürfen Steckersolaranlagen mit bis zu 800 Watt Wechselrichterleistung betrieben werden, wobei die Module bis zu 2000 Watt Leistung haben dürfen. Steckersolaranlagen müssen im Marktstammdatenregister (MaStR) angemeldet werden, aber nicht mehr beim Netzbetreiber. Mieter und Wohnungseigentümer haben das Recht, diese Anlagen zu installieren, auch gegen den Widerstand des Vermieters. Der Anschluss mit einem herkömmlichen Schukostecker ist geplant, wird aber noch nicht als Standard anerkannt.
• Wichtige Regelungen im Überblick:
∘ Leistungsgrenzen:
Bis zu 800 Watt AC-Wechselrichterleistung und 2000 Watt PV-Modulleistung sind zulässig.
∘ Anmeldung:
Die Anlage muss im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur registriert werden. Eine zusätzliche Anmeldung beim
Netzbetreiber entfällt.
∘ Zustimmungspflicht:
Mieter und Eigentümer haben nun ein Recht auf Installation von Steckersolaranlagen und müssen keine Zustimmung der
Eigentümergemeinschaft einholen.
∘ Zähler:
Der Betrieb mit einem analogen Stromzähler (Ferraris-Zähler) ist bis zur Erneuerung durch einen modernen Zähler
(Zweirichtungszähler) vorübergehend erlaubt.
∘ Stecker:
Die Verwendung des Schukosteckers ist geplant, aber die entsprechenden Normen werden noch überarbeitet. Bis dahin sollte die
Anlage fachmännisch geprüft und gegebenenfalls mit einer speziellen Energiesteckdose installiert werden.
• Vorteile des Solarpakets 1:
∘ Vereinfachte Anmeldung:
Der Prozess der Registrierung im Marktstammdatenregister wurde erheblich vereinfacht.
∘ Mehr Flexibilität:
Die höhere Leistungsgrenze ermöglicht eine effizientere Nutzung der Solarenergie.
∘ Steuerliche Erleichterungen:
Seit 2023 ist die Mehrwertsteuer für Solaranlagen entfallen, was die Anschaffungskosten senkt.
∘ Wichtiger Hinweis:
Die Anlage muss sicher befestigt werden, um Sturmschäden zu vermeiden. Bei Unsicherheiten zur Elektroinstallation sollte ein
Fachmann konsultiert werden.
• Solarpaket I (Zusammenfassung von Google-KI)
Das Solarpaket I ist ein Gesetzespaket der deutschen Bundesregierung, das im Mai 2024 verabschiedet wurde, um den Ausbau der Photovoltaik (PV) zu beschleunigen. Es enthält zahlreiche Vereinfachungen und Erleichterungen für den Bau und Betrieb von PV-Anlagen, von Balkonkraftwerken über Dachanlagen bis hin zu Freiflächenprojekten. Zentrale Neuerungen umfassen die Ausweitung der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung, eine Erleichterung bei der Anmeldung und Nutzung von Balkonkraftwerken, und Vereinfachungen bei Genehmigungsverfahren sowie bei der sogenannten Anlagenzusammenfassung.
• Wichtige Maßnahmen im Überblick:
∘ Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung (GGV):
Ermöglicht die gemeinsame Nutzung von lokal erzeugtem Solarstrom innerhalb eines Gebäudes, beispielsweise für Mietende.
∘ Balkonkraftwerke:
Die Leistungsgrenze für Wechselrichter wird von 600 Watt auf 800 Watt erhöht.
Eine Anmeldung ist künftig nur noch im Marktstammdatenregister notwendig.
Die Anlagenzusammenfassungregeln werden für Balkonkraftwerke ausgesetzt.
∘ Anlagenzusammenfassung:
Eine wichtige Erleichterung, da diese Regelung nun für Dachanlagen an verschiedenen Netzanschlusspunkten und für
Balkonkraftwerke nicht mehr gilt, was die Berechnung von PV-Anlagen vereinfacht.
∘ Gewerbliche PV-Anlagen:
Es wurde eine Erhöhung der Einspeisevergütung für Dachanlagen zwischen 40 und 750 kWp eingeführt.
∘ Freiflächenanlagen:
Die Obergrenze für die Förderung von Freiflächenanlagen wurde von 20 MW auf 50 MW angehoben.
∘ Anschluss an das Netz:
Die Nutzung von alten Ferraris-Zählern ist weiterhin erlaubt, bis ein digitaler Zähler installiert ist.
• Ziele des Solarpakets I:
∘ Beschleunigung des PV-Ausbaus:
Das Gesetzespaket zielt darauf ab, die ambitionierten Klimaschutzziele zu erreichen, indem es den Ausbau der Photovoltaik
deutlich erleichtert.
∘ Erhöhung der Flexibilität:
Durch die Vereinfachung der Regelungen sollen Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen ermutigt werden, Photovoltaikanlagen
zu installieren und Solarenergie zu nutzen.
• Solarpaket II (Zusammenfassung von Google-KI)
Das Solarpaket II ist eine geplante Reihe von Maßnahmen der deutschen Bundesregierung zur Beschleunigung des Ausbaus erneuerbarer Energien, insbesondere der Photovoltaik. Ziel ist es, durch Vereinfachungen, Bürokratieabbau und neue Konzepte wie Energy Sharing und Mieterstromprojekte die Nutzung von Solarenergie für Privathaushalte und Unternehmen zu erleichtern und den Prozess des Netzanschlusses zu beschleunigen. Das Solarpaket I ist bereits im April 2024 in Kraft getreten, während die genauen Inhalte und das Inkrafttreten des Solarpakets II noch nicht abschließend festgelegt sind, aber weitere Vereinfachungen für Anlagenbetreiber beinhalten sollen.
• Ziele des Solarpakets II
∘ Beschleunigung des Ausbaus erneuerbarer Energien:
Das Solarpaket II soll als "Booster" für den Ausbau von Solarenergie dienen.
∘ Vereinfachung für Privathaushalte:
Es sollen bürokratische Hürden abgebaut und Prozesse vereinfacht werden, um die Anschaffung und Installation von Solaranlagen
zu erleichtern.
∘ Förderung von Innovationen:
Neue Konzepte wie Energy Sharing und Mieterstrom sollen den Zugang zu Solarenergie erleichtern.
∘ Digitalisierung von Prozessen:
Die Digitalisierung soll dazu beitragen, die Anmeldeprozesse zu beschleunigen und die Marktlokationsnummer innerhalb von
24 Stunden zu erhalten.
• Konkrete Maßnahmen und Neuerungen (Geplant/Diskutiert)
∘ Beschleunigter Netzanschluss:
Das Solarpaket II soll die Vergabe der Marktlokationsnummer beschleunigen, sodass diese automatisch innerhalb von 24 Stunden
erfolgt.
∘ Optimierte Anlagensteuerung:
Ab 2025 soll die Anlagensteuerung durch die Integration von Smart Metern und zertifizierten Steuerboxen für Anlagen über 7 kW
optimiert werden.
∘ Energy Sharing:
Nachbarn sollen künftig Solarstrom gemeinsam nutzen können und dabei von vergünstigten Netzentgelten profitieren.
∘ Förderung von Mieterstromprojekten:
Die Bedingungen für Mieterstromprojekte sollen verbessert werden.
∘ Erleichterungen bei denkmalgeschützten Gebäuden:
Der Zugang zu Solarenergie soll auch auf denkmalgeschützten Gebäuden erleichtert werden.
∘ Einheitliche Anschlussbedingungen:
Es sollen einheitliche Anschlussbedingungen geschaffen werden, um die Anschaffung von Solaranlagen zu vereinfachen.
• Status und Ausblick
∘ Das Solarpaket I ist bereits in Kraft getreten und beinhaltet beispielsweise die Erhöhung der Leistungsgrenze für Balkonkraftwerke und
die Vereinfachung der Anmeldeprozesse.
∘ Das Solarpaket II ist eine Erweiterung und wird derzeit von der Bundesregierung und der Branche diskutiert und soll in der zweiten
Jahreshälfte 2024 in die Gesetzgebung gehen. Die genauen Inhalte und das Inkrafttreten des Solarpakets II sind noch nicht
abschließend geklärt. Wurde nie als Rechtsverordnung verkündet!
• Solarspitzengesetz (Zusammenfassung von Google-KI)
Das Solarspitzengesetz, auch als EnWG-Novelle bezeichnet, ist eine am 25. Februar 2025 in Kraft getretene deutsche Regelung, die darauf abzielt, die Integration von Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) zu verbessern und Netzüberlastungen bei hohem Solarstromaufkommen zu vermeiden.
Neue Anlagen dürfen zunächst nur 60 % ihrer Nennleistung einspeisen, bis eine Steuerbox installiert ist, und bei negativen Strompreisen entfällt die Einspeisevergütung.
Das Gesetz fördert den Eigenverbrauch, Speicher und flexible Marktoptionen wie Direktvermarktung, um die Netzstabilität zu gewährleisten und die Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen zu sichern.
• Wichtige Änderungen und Auswirkungen des Solarspitzengesetzes:
∘ 60-Prozent-Regel für neue Anlagen:
PV-Anlagen, die ab dem 25. Februar 2025 in Betrieb genommen werden, dürfen nur 60 % ihrer Nennleistung einspeisen. Dies wird
durch eine zu installierende Steuerbox sichergestellt, um unkontrollierte Einspeisespitzen zu verhindern.
∘ Keine Einspeisevergütung bei negativen Strompreisen:
Wenn der Strom an der Börse negativ ist, wird für die Einspeisung keine Vergütung gezahlt. Dies soll negative Strompreise nicht länger
durch starre Einspeisung verstärken.
∘ Förderung von Eigenverbrauch und Speichern:
Um die negativen Auswirkungen von negativen Preisen und Einspeisebeschränkungen zu mindern, wird der Eigenverbrauch durch
intelligente Steuerung und Speicher attraktiv gemacht.
∘ Verpflichtung zu Smart Metern:
Die Installation eines intelligenten Messsystems (Smart Meter) wird für Neuanlagen mit mehr als 7 kWp Leistung Pflicht.
Dies ermöglicht eine Echtzeit-Überwachung und die Grundlage für die Steuerbarkeit der Anlagen.
∘ Vereinfachte Direktvermarktung:
Das Gesetz macht die Direktvermarktung für Betreiber kleinerer Anlagen einfacher und flexibler, um überschüssigen Strom zu den
bestmöglichen Börsenpreisen zu verkaufen.
∘ Einführung der ZEREZ-ID:
Seit dem 1. Februar 2025 ist die Nutzung der ZEREZ-ID verpflichtend. Sie ermöglicht eine zentralisierte Überprüfung und Übermittlung
von Zertifikaten, was den Netzanschluss effizienter und digitaler macht.
• Chancen und Herausforderungen für Anlagenbetreiber:
∘ Neue Chancen für den Eigenverbrauch:
Durch Speichersysteme und Energiemanagement können Betreiber Strom dann nutzen, wenn er am günstigsten ist.
∘ Investition in Speicher und Steuerbox:
Um die volle Leistung zu nutzen und die Einspeisebeschränkungen zu umgehen, ist die Installation einer Steuerbox und eines
Speichers sinnvoll.
∘ Steuerbare Anlagen:
Das Gesetz fördert die Flexibilität und Steuerbarkeit von Anlagen, was langfristig zu höheren Erträgen führen kann.
∘ Anpassung der Prozesse:
Anlagenbetreiber und -installateure müssen sich auf die neuen Regelungen und die Anforderungen an die digitale Datenerfassung
einstellen.
• Netzdienlichkeit (Zusammenfassung von Google-KI)
Netzdienlichkeit ist die Fähigkeit einer elektrischen Anlage (wie Photovoltaik, Speicher oder Wärmepumpe), aktiv zur Stabilität, Sicherheit und Effizienz des Stromnetzes beizutragen, indem sie ihr Betriebsverhalten an die Netzanforderungen anpasst, um Engpässe zu vermeiden und die Balance von Stromangebot und -nachfrage zu unterstützen. Dies geschieht beispielsweise durch die Steuerung des Lade- und Entladeverhaltens oder durch die Anpassung des Stromverbrauchs, was durch Standards wie ![]() § 14a EnWG und Schnittstellen wie
§ 14a EnWG und Schnittstellen wie ![]() SG Ready umgesetzt wird.
SG Ready umgesetzt wird.
• Was bedeutet das konkret?
∘ Aktive Anpassung an das Netz:
Eine netzdienliche Anlage reagiert nicht nur auf den eigenen Bedarf, sondern auch auf die Bedürfnisse des Stromnetzes.
Sie kann zum Beispiel:
- Energie speichern, wenn viel erneuerbare Energie im Netz ist, und diese bei Bedarf wieder abgeben.
- Den Stromverbrauch verschieben, um die Nachfrage besser an die Verfügbarkeit erneuerbarer Energien anzupassen
(Nachfragesteuerung oder Demand Response).
- Auf Signale von Netzbetreibern reagieren, um kritische Situationen zu entschärfen.
∘ Vorteile für das Netz:
Durch netzdienliche Anlagen wird das Stromnetz entlastet und stabilisiert:
- Vermeidung von Engpässen:
Anlagen helfen, Überlastungen im Netz zu verhindern.
- Reduzierung von Kosten:
Der Bedarf an kostenintensivem Netzausbau und die Kosten für den Einsatz von Redispatch (der Ausgleich von Ungleichgewichten
im Netz) können reduziert werden.
- Bessere Integration erneuerbarer Energien:
Die Schwankungen der erneuerbaren Energien werden besser ausgeglichen, was die Integration dieser in das Stromnetz erleichtert.
• Beispiele für netzdienliche Anlagen:
∘ Batteriespeicher:
Sie können überschüssige Energie aufnehmen und abgeben, um Schwankungen auszugleichen.
∘ Wärmepumpen:
Mit der richtigen Schnittstelle (z. B. SG Ready) können sie ihren Betrieb zeitlich anpassen, um die Netzbelastung zu optimieren.
∘ Ladestationen für Elektrofahrzeuge:
Sie können das Laden von E-Autos so steuern, dass es nicht zu Spitzenlasten im Netz kommt.
• Warum ist Netzdienlichkeit wichtig?
∘ Energiewende:
Im Zuge des Ausbaus erneuerbarer Energien wird ein flexibles und stabiles Netz benötigt. Netzdienlichkeit ist eine Schlüsselstrategie,
um diese Anforderungen zu erfüllen.
∘ Gesetzliche Vorgaben:
Anforderungen zur Netzdienlichkeit sind in Deutschland im § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) festgelegt, der den Einsatz
von steuerbaren Verbrauchern und Speichern regelt.
Dietrich Tilp 11.2025